Depression - ein ernstzunehmender "Gast" im Lebensbogen
Laut aktuellen Statistiken leiden 33,4 Millionen, also ca. 7,5% der Europäer, an einer depressiven Erkrankung. Innerhalb eines Jahres haben mindestens 6% aller Menschen mit depressiven Phasen zu kämpfen. Fast jeder fünfte Bürger der OECD-Staaten wird im Laufe seines Lebens an einer Depression erkranken. Allein in der EU begehen 78.000 (!) Menschen jährlich Suizid.
Mit diesen Zahlen nimmt die Depression einen Platz im Spitzenfeld der häufigsten Krankheiten ein – im Jahre 2020, meint die WHO, wird sie zum zweithäufigsten Krankheitsbild weltweit gehören, und die häufigste in der "entwickelten" Welt sein. Allerdings vergehen durchschnittlich rund 11 Monate, bevor Menschen mit einer Depression ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen – und nur ein Drittel der Betroffenen sucht diese Hilfe überhaupt jemals (Harris Interactive, 2005). Depression gehört damit, wie auch noch zahlreiche andere neuere Studien zeigen, zu den häufigsten und am meisten unterschätzten Krankheiten. Viel wertvolle, unter Umständen lebensrettende Zeit vergeht, bevor depressiv Erkrankte angemessen behandelt werden. Und die Gründe für oftmals sehr spät beginnende und vor allem erst spät "greifende" Behandlungen sind zahlreich:
- Unauffälliger Beginn: Depression beginnt häufig schleichend, unspezifisch. Nur die wenigsten Menschen also werden von einer Depression sprichwörtlich "ereilt" - ein Aha-Erlebnis, das dann wohl auch häufiger rasch zum Arzt oder Therapeuten führen würde, ist selten. Vielmehr ist es meist so, dass viele Betroffene, erst einmal in der Arzt- oder Therapiepraxis angekommen, berichten, schon lange Zeit unter Phasen von Niedergeschlagenheit, Grübeln, Demotivation oder Traurigkeit zu leiden, welche zunächst jedoch immer wieder "wie von selbst" vergingen oder nach "Selbstbehandlungen" aller Art recht gut in den Griff zu bekommen waren.
- körperliche Symptomatik ist oftmals nicht mit Depressionen assoziiert: die überwiegende Mehrheit der Patienten (lt. der Harris-Studie: 72%) mit mittelschwerer und schwerer Depression wußte nicht, dass neben den klassischen Depressionssymptomen wie Niedergeschlagenheit, Interessenverlust und Antriebsmangel auch körperliche Beschwerden (z.B. chronische Kopf-, Muskel- oder Rückenschmerzen) häufige Symptome einer klinisch manifesten depressiven Erkrankung sein können. Gerade diese körperlichen Depressionssymptome sind jedoch mit einem hohen subjektiven Leidensdruck verbunden und in vielen Fällen (bei 79% der im Rahmen dieser Untersuchung befragten Patienten) der ausschlaggebende Grund, zumindest einmal den Hausarzt aufzusuchen.
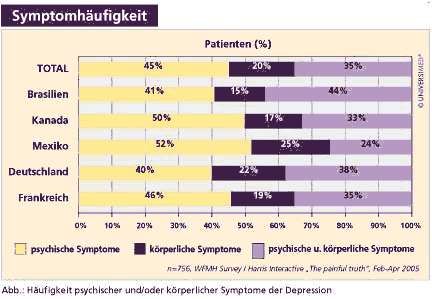
(Quelle: www.who.int/mental_health/management/depression/definition/en/) - bei vorhandener Diagnose wird von vielen Betroffenen – aufgrund der Scham, die sie angesichts psychischer Probleme empfinden einerseits und dem Vertrauensverhältnis andererseits - wenn überhaupt, dann zunächst einmal der Hausarzt konsultiert. Praktische Ärzte jedoch sind nicht in erster Linie Fachleute für psychische Beschwerdebilder, und fokussieren aufgrund ihrer medizinischen Ausbildung nicht nur vorrangig auf die häufig bei einer Depression anzutreffenden körperlichen Symptome, sondern selbst dann auf eine rein somatische Behandlung, wenn keine körperliche Symptomatik vorliegt. In den Anamnesen von Patienten mit Depressionen finden sich sehr häufig jahrelange, rein körperliche Symptombehandlung sowie rein medikamentöse Behandlungen der psychischen Depressionssymptome, und dies fallweise sogar mit bereits veralteten Typen von Arzneimitteln. Es muß also festgestellt werden, daß praktische Ärzte viel zu selten von ihrer Aufgabe und Möglichkeit der Weiterüberweisung an Fachkollegen (Neurologen, Psychiater, Psychotherapeuten) Gebrauch machen, geschweige denn die so wichtige diagnostische Abklärung einleiten, was vielleicht aber auch Tätigkeiten sind, für die in den Praxen der Kassenärzte häufig auch gar nicht genügend Zeit ist. Die Folgen aber sind jahrelang nicht nach heutigem wissenschaftlichen Stand behandelte Depressionen und in vielen Fällen wohl auch unnötiges Leiden der Patienten, sowie – auch dies eine Wirkung, die nicht verschwiegen werden darf - eine unnötige Belastung
der Sozialversicherungsträger.
- Empfundenes Stigma psychischer Krankheiten: in Kooperation mit bemühten, aber fachlich überforderten Hausärzten versuchen die Betroffenen häufig jahrelang, ihre Stimmungsschwankungen in den Griff zu bekommen, und sie mit Medikamenten, Alkohol, Drogen oder sonstigen Substanzen zu übertauchen. Die Depressionen in nahezu allen Fällen mitverursachenden psychischen Faktoren bleiben dabei jedoch weitestgehend unberücksichtigt und unbehandelt, ja werden mitunter aktiv bis hin zur Selbstverleugnung verdrängt ("manchmal ist es schon besser..")
Besonders schlimm und folgenschwer ist die Verdrängung der Depression aber, wenn sie sogar dem Arzt gegenüber verschwiegen wird: 75% der Suizide älterer Amerikaner etwa fanden statt, obwohl diese innerhalb der letzten 30 Tage ihren Arzt gesehen hatten: wie kann so etwas geschehen?
Aktueller Stand professioneller Behandlungsstrategien der Depression
In der Fachwelt besteht heute Konsens darüber, dass sämtliche im Rahmen einer Depression möglichen Symptome und Ursachen, also sowohl psychische als auch somatische Aspekte der Erkrankung, adäquat behandelt werden müssen, soll eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine Vollremission (vollständige und dauerhafte Heilung) der Depression erzielt werden.
Der mittlerweile schon jahrzehntelange Erfahrungsschatz der Mediziner und Psychotherapeuten zeigte nämlich, dass nur bei den wenigsten Patienten eine dauerhafte Verbesserung der Symptomatik mit rein medikamentöser Behandlung erzielt werden kann. Kritiker rein pharmakologischer Therapien werfen diesen sogar vor, dass die ausschließlich pharmakologische Behandlung es Menschen ermöglicht, vorhandene psychische Mitauslöser der Depression nur besser zu "ertragen", also insgesamt lediglich eine bessere Funktion und Leistungsfähigkeit zu erreichen - die zugrundeliegende Problematik damit aber verschleiert wird. Wäre dies so, dann würde der Mensch als fühlendes, verletzliches, hochgradig lern- und veränderungsfähiges Individuum im Grunde entwertet und tendentiell als Maschine, die unter Inkaufnahme späterer Folgeschäden wieder zu "reparieren" wäre, betrachtet. Was Mediziner vehement von sich weisen dürften, ist aber in der Tat auch ein häufiges Anliegen der Patienten selbst, die nach medikamentöser Therapie suchen: sie wollen vor allem ihre Leistungsfähigkeit im Beruf erhalten und unauffällig bleiben – die Lösung etwaiger persönlicher Probleme wird im Vergleich damit als nicht relevant dargestellt oder auf später verschoben; es fällt ihnen schwer, eine persönliche "Schwäche" (als die sie ein psychisches Problem empfinden) wichtig genug zu nehmen, um sich mit dieser etwa im Rahmen einer Therapie (die ja genau dieses bedeutet: näher hinzusehen und es sich zu erlauben, die offensichtliche Bedürftigkeit der eigenen Person endlich in den Mittelpunkt des eigenen Interesses zu rücken) auseinanderzusetzen. Als Folge dieses Umgangs mit den frühen Phasen von Depressionen passiert es leider allzu häufig, dass Patienten nach jahrelanger medikamentöser Depressionsbehandlung oder "Selbstbehandlung" mit Tipps aus Ratgebern oder dem Internet (mitunter bis zur Bestellung von Arzneimitteln aus dubioser Quelle), mit ausgewachsenen, chronifizierten, mittelschweren bis schweren Depressionen oder sog. "Burnouts" in der psychotherapeutischen Praxis oder einer Klinik landen und dann nur mehr mit Mühe medikamentös so eingestellt werden können, dass sie überhaupt wieder (psycho)therapiefähig werden.
Insbesonders bei diesen mittelschweren oder schweren Depressionen reicht ein psychotherapeutischer Ansatz allein aufgrund des Leidensdrucks dann nämlich häufig nicht mehr aus. Auch ist durch Psychotherapie keine Behandlung der bei schwereren Depressionsformen so häufigen somatischen Begleitsymptome möglich (speziell hinsichtlich adäquater Schmerzkontrolle), die sich zudem ungünstigerweise auf negative Weise mit den rein psychischen Symptomen rückkoppeln könnten. Etwa 2/3 (in der Harris-Studie 61%) der Patienten geben an, unter der aktuellen Medikation zwar eine Besserung der emotionalen Depressionssymptome, nicht jedoch der körperlichen Beschwerden zu verspüren. Viele dieser Patienten berichteten deshalb, zusätzlich oder sogar ersatzweise Analgetika einzunehmen, was mit gesundheitlichen Folgerisiken assoziiert ist. Hier erweist sich die Vorteilhaftigkeit moderner dualer Antidepressiva, die aufgrund ihres kombinierten serotonerg-noradrenergen Wirkmechanismus das gesamte Symptomspektrum der Depression beeinflussen.
Aber selbst, wenn keine somatischen Symptome vorliegen, ist es in vielen Fällen nötig oder zumindest sinnvoll, die Psychotherapie einige Zeit lang mit medikamentöser Stützung zu begleiten, um eine bessere "Therapiefähigkeit" zu erzielen. Dies bedeutet, dass der Patient in eine bessere Grundstimmung, möglichst frei von psychischer Einengung durch die depressive Symptomatik, versetzt wird und es ihm dadurch leichter fällt, sich für den eigentlichen therapeutischen Prozeß zu öffnen, die Psychotherapie also konstant und ohne ständige Ablenkung durch allzutiefe Stimmungstäler verfolgen zu können. Der Erfahrung des Autors nach wäre es in der überwiegenden Mehrheit der Fälle möglich, nach einigen Monaten intensiver Psychotherapie die Medikation in Absprache mit dem Klienten und dem behandelnden Arzt schrittweise und gezielt zu reduzieren, die Medikamente sukzessive "auszuschleichen", da die PatientInnen durch die nachhaltigen therapeutischen Veränderungen bereits ein ausreichendes Maß an Tragfähigkeit entwickelt haben, mit Stimmungsschwankungen oder belastenden Umwelteinflüssen auch selbst, ganz ohne "chemische Stütze", umzugehen. Ein mit sich und den anderen im Einklang stehender, und in seinem Leben glücklicher Mensch benötigt keine (Psycho-)Medikamente! Mit einer derartigen Kombinationstherapie sind diesbezüglich in der Regel außergewöhnlich gute, und vor allem auch dauerhafte Erfolge zu erzielen.
Eine Ausnahme stellen extreme Fälle schwerer, schon sehr langdauernder Depressionen dar (bei welchen Mediziner kausale körperliche, wie z.B. genetische oder anderwertig nicht behebbare stoffwechselbedingte Ursachen vermuten) – hier kann es sich als hilfreich erweisen, wenn auch nach dem Ende der akuten Therapie weiterhin Psychopharmaka eingenommen und/oder regelmäßige, stützende Psychotherapie-Sitzungen abgehalten werden (wenn auch z.B. in größeren Abständen), um einen möglichst stabilen Gesamtrahmen zu errichten, in welchen Anflüge von Krisen sofort abgefangen werden können.
Ergebnisse aus der Neurobiologie
 Die Forschungsergebnisse aus Medizin und Neurobiologie deuten auf ausserordentlich komplexe Zusammenhänge zwischen Körper und Depression (als emotionalem Zustand) hin. Erleidet jemand zB. einen Herzinfarkt, hat er ein 3½-mal größeres Risiko zu sterben, wenn er gerade auch an einer Depression leidet. Ebenso hat er ein deutlich höheres Risiko, an Diabetes oder Osteoporose zu erkranken, und ist schon von vornherein viel anfälliger für einen Herzinfarkt: die körperlichen Befunde von an Depressionen Erkrankten wirken mitunter so, als würden diese schon jahrelang an chronischen Herzerkrankungen leiden. Umgekehrt zeigt die Behandlung von Diabetes-Kranken deutlich bessere Erfolge, wenn gleichzeitig damit auch eine etwaige Depression behandelt wird. Offensichtlich gibt es also auch bezüglich der Depression eine nachweisliche und unübersehbare Wechselwirkung zwischen unserem Körper und unserer Psyche – wir wissen nur noch nicht, wie diese genau fuktioniert.
Die Forschungsergebnisse aus Medizin und Neurobiologie deuten auf ausserordentlich komplexe Zusammenhänge zwischen Körper und Depression (als emotionalem Zustand) hin. Erleidet jemand zB. einen Herzinfarkt, hat er ein 3½-mal größeres Risiko zu sterben, wenn er gerade auch an einer Depression leidet. Ebenso hat er ein deutlich höheres Risiko, an Diabetes oder Osteoporose zu erkranken, und ist schon von vornherein viel anfälliger für einen Herzinfarkt: die körperlichen Befunde von an Depressionen Erkrankten wirken mitunter so, als würden diese schon jahrelang an chronischen Herzerkrankungen leiden. Umgekehrt zeigt die Behandlung von Diabetes-Kranken deutlich bessere Erfolge, wenn gleichzeitig damit auch eine etwaige Depression behandelt wird. Offensichtlich gibt es also auch bezüglich der Depression eine nachweisliche und unübersehbare Wechselwirkung zwischen unserem Körper und unserer Psyche – wir wissen nur noch nicht, wie diese genau fuktioniert.
G.Roth (2000) weist erstmals auf derartige Zusammenhänge auch im menschlichen Gehirn hin: versuchen Forscher heutzutage ja meist, unerwünschte psychische Zustände mit physiologischen Fehlfunktionen (etwa bedingt durch genetische Vorbelastung, hormonell bedingte Stoffwechselschwankungen oder Störungen im Neurotransmitterhaushalt) zu erklären, zeigt er auf, dass die hypothetische Kausalbeziehung in dieser Form gar nicht existiert, sondern auch in umgekehrter Richtung funktioniert: die Psyche kann den Neurotransmitterhaushalt beeinflussen und wirkt sogar auf hirnorganische Zusammenhänge wie etwa neuronale Verbindungen im Gehirn ("Plastizität" des Gehirns bzw. Neuroplastizität1 ). Die Konsequenzen dieser bemerkenswerten Entdeckungen sind in ihren Dimensionen noch gar nicht zu erahnen - machen den Menschen in der Auwirkung aber in hohem Maße auch dafür verantwortlich, selbst "etwas für sich zu tun", will er eine Änderung herbeiführen: Schicksal ist, so gesehen, zu einem Teil auch selbst gemacht. Die moderne Neurobiologie bestätigt in diesem Bereich die modernen Richtungen der Psychotherapie, wie etwa die stark durch Konstruktivismus und Kybernetik beeinflußte Systemische Einzel-, Paar und Familientherapie.
Gesellschaftliche Aspekte der Depression
Die Depression ist als Krankheitsbild während der letzten Jahre deutlich ins Licht der Medienaufmerksamkeit gerückt. Wie immer ist es sinnvoll, sich bei solchen Anlässen zu fragen: warum? und: warum gerade jetzt? Mehrere Erklärungen bieten sich an.
Zum einen haben sich die Diagnosemöglichkeiten deutlich verbessert. Sind Krankheitsbilder genauer beschrieben und erforscht, ermöglicht dies eine klarere Identifikation einschlägiger Symptome und eine Benennung dessen, was sonst nur ein undefinierbares Gefühl ist. Andererseits hat es häufig den Anschein, dass es sich beim Krankheitsbild der Depression oft auch um eine Sammel- oder Verlegenheitsdiagnose handelt, unter der zahlreiche nicht genauer spezifizierbare Symptome (insbesondere psychischer Art) subsumiert werden. Zahlreiche praktischen Ärzte etwa diagnostizieren psychische Beschwerden als "Depressionen" (und, was noch schlimmer ist: verschreiben konsequenterweise auch entsprechende Medikamente!), die ein Psychotherapeut aufgrund seiner Erfahrung sofort als anderes Krankheitsbild klassifizieren würde. Sehr häufig ist dies etwa bei Angststörungen (insb. Sozialer Phobie), Zwangsstörungen, Problemen rund um Selbstsicherheit und Selbstwert, Borderline-Störung, "Burnout"-Syndrom u.a. der Fall.
Um angesichts der Diagnoseproblematik fehlgeleitete Schlußfolgerungen hintanzuhalten, muß allerdings angemerkt werden, dass davon auszugehen ist, dass das Krankheitsbild "Depression" tatsächlich ein sehr häufiges ist, und dabei eng mit unserer Gesellschaft, unserer Art, zu leben und der Arbeitswelt, in der wir leben, verknüpft zu sein scheint. In diese Richtung weisen auch neuere Forschungen aus Schwellenländern wie Thailand, China u.a., die eine rapide Zunahme von Depressionen in der Bevölkerung zeigten, seit dort die wirtschaftlichen Erfolge zunehmen – was zunächst dem aus zahlreichen Studien bekannten Fakt, dass in der Unterschicht Depressionen häufiger auftreten als in der Mittel- oder Oberschicht (Mielck 2000; Helmert 2003; Lampert, Ziese 2005) zu widersprechen scheint. Der deutliche Anstieg der Zahlen scheint sich aber dennoch vor allem aus jenen Bevölkerungsschichten zu rekrutieren, die eigentlich zu den ökonomischen Gewinnern zählen, wonach die Hypothese zu erwägen ist, dass insbesondere von Angehörigen einer "gemäßigten" Mittel- und Oberschicht für noch mehr kapitalistischen Erfolg offenbar auch ein überproportional höherer persönlicher Preis, ein Verlust an Quellen für persönliches Glück zu bezahlen ist. Das "Mehr" an Geld, Konsum und Besitz scheint also nicht notwendigerweise glücklicher zu machen, sondern vielmehr für Menschen einen Nährboden für Sinnverlust und Perspektivenlosigkeit darzustellen, betrachtet man diese als zu potentiellen Grundpfeilern von Depressionen zählend.
Beachtenswert für unsere Suche nach Gründen für die Zunahme der Diagnose "Depression" ist auch die immer enger werdende Verflechtung von Pharmakonzernen und Gesundheitspolitik. Die Ausgaben der Sozialversicherungen für Arzneimittel stiegen während der letzten Jahrzehnte explosiv an und konnten erst während der letzten zwei Jahre durch den verstärkten Einsatz von Generika erstmals gesenkt werden (was jedoch nichts über die Mengen der verschriebenen Medikamente aussagt – es ist vielmehr davon auszugehen, dass diese unverändert weiter ansteigen). Gleichzeitig findet sich kaum eine Gesundheitsbroschüre oder ein von der öffentlichen Hand herausgegebener Aufklärungs-Flyer, der nicht von Pharmaunternehmen finanziert wurde. Warum? Und zu welchem Preis?
Ist unter diesen Rahmenbedingungen ausreichende Neutralität der Information in Bezug auf Therapiemöglichkeiten zu erwarten, ganz zu schweigen von der adäquaten Behandlung der Patienten – abseits der Produktpalette von Bayer & Co? Hinsichtlich dieser Gewichtungen forschungs- und sozialpolitisch nur konsequent, können wir derzeit auch eine deutliche Verschiebung des wissenschaftlichen Beobachtungsfokus hin zu "querfinanzierbaren" Forschungsergebnissen beobachten, während sich der Staat aus seinen traditionellen gesundheitspolitischen Verantwortungsbereichen zunehmend zurückzieht. Pharmaunternehmen wiederum erforschen – ebenso wie Mediziner – naturgemäß vor allem die somatischen Aspekte von Erkrankungen, da sie unter den Mikroskopen sichtbares "Material" benötigen, das sie untersuchen und später auch beeinflussen können. Interessanterweise werden dabei dann weite Flächen der aktuellen Erkenntnisse etwa aus der Neurobiologie völlig weggewischt, wenn es um die Therapie psychischer Störungen geht. "Gene" oder "neurochemische" Vorgänge werden als kausale Ursachen psychischer Probleme dargestellt statt zu berücksichtigen, dass psychische Befindlichkeiten ebendiese neurochemischen Vorgänge erheblich beeinflussen und, wie die oben erwähnten Untersuchungen zeigen, sogar zu organischen Veränderungen führen können.
Die explosionsartige Zunahme des Einsatzes von Psychopharmaka verwundert, von dieser Perspektive aus betracht, gar nicht. Böse Zungen könnten behaupten, dass das, was für den Kapitalismus der ideale Staatsbürger ist (nämlich der Konsument, der sich ständig mit den neuesten Produkten eindeckt, auch wenn er diese im Grunde gar nicht benötigt) für die Pharmakonzerne der "ewige Patient" (und damit Kunde) ist: der Mensch, der täglich eine gewisse Anzahl an Tabletten benötigt, um sein psychisches Wunschgefühl erzeugen und den Alltag ohne größere psychische Schwankungen bestehen zu können.
Persönlich – in meiner Eigenschaft als Psychotherapeut – kann ich nicht umhin, anzumerken, dass Psychotherapie von diesem Blickwinkel aus betrachtet, geradezu das "Antidote" ist, das Feindbild, der Angstgegner – was ist für die Aktienkurse der Pharmaindustrie bedrohlicher als ein Mensch, der sich selbst helfen kann, der auf eigenen Beinen steht? Viel angenehmer ist da das Erklärungsmodell, dass – gehen wir von den aktuellen Statistiken aus – offenbar immer größer werdende Teile der Bevölkerung an einer -zuvor nur noch unentdeckten!- Gen-Anomalie oder an einem aus den Fugen geratenen hirnchemischen Gleichgewicht leiden, das – keine Sorge, zählen Sie auf uns! - mit Pülverchen aber "ganz easy" wieder ausgeglichen werden kann.
Der Eindruck, Ziel dieses Artikels sei es, "Pharma-bashing" betreiben, wäre dennoch verfehlt: innovative Medikamente helfen auch, Kosten einzusparen. Neuere Produktgenerationen auf dem Pharmasektor sind gerade im Psychopharmaka-Bereich oft verträglicher, insbesondere langfristig (man denke etwa an die noch vor 10 Jahren eingesetzten, mit enormen Langzeitschäden verbundenen Neuroleptika, für die es heute verhältnismäßig gute Alternativen gibt). Bedauerlich ist allerdings, und dies kann nicht genug betont werden, dass sich die Psychotherapie trotz einer mittlerweile hundertjährigen Tradition und Weiterentwicklung immer noch um ihre Position in der Gesundheitspolitik ringen muß, und ihr Einsatz nicht einmal bei eindeutig psychischen Erkrankungen ein zumindest gleichrangiges Standardverfahren darstellt (was angesichts ihrer im Vergleich mit Psychopharmaka nachgewiesenerweise langfristigen Wirksamkeit eigentlich nur verwundern kann). Dass Patienten nicht einmal darauf vertrauen können, von ihren Ärzten diesbezüglich fachgerecht beraten zu werden, ist bedauerlich und Mitursache für einen häufig jahrelangen Leidensweg vieler Betroffener, die in einem Frühstadium der Depression, fachgerecht unterstützt, weitaus bessere Prognosen hätten.
(Werbeeinschaltung)
Formen der Depression
Der ICD-10, das von der WHO herausgegebene Internationale Klassifikationsschema der Krankheiten, zählt die depressiven Störungen zur Gruppe der sog. Affektiven Störungen.
Unipolare Depression
Die unipolare Depression, zu der 'depressive Episoden' (ICD-10: F32) sowie 'rezidivierende depressive Störungen' (ICD-10: F33) gezählt werden, ist die häufigste depressive Erkrankung. Der Name "unipolar" (=einpolig) kommt daher, dass die Patienten nur depressive, aber keine manischen Phasen haben. Hauptsymtome sind das Morgentief, frühe Aufwachen, Schlafstörungen in der zweiten Nachthälfte und Niedergeschlagenheit.
Zu den unipolaren Formen der Depression gehört auch die so genannte "Major Depression". In Fachkreisen stark kritisiert wurde, dass die Diagnosekriterien für schwere Depressionsformen wie die genannte in der im Jahre 2014 neu erschienenen Version des DSM-Manuals (DSM-5) nahezu unverändert blieben, ja sogar gesenkt wurden - damit wird die Schwelle zu psychischen Krankheit gesenkt, und vermutlich werden Ärzte bald auch eine Reihe an sich gesunder Menschen mit Medikamenten und deren Nebenwirkungen behandeln. So kann dem DSM-5 zufolge eine Depression nun bereits nach einer 2-wöchigen Trauerreaktion (etwa nach dem Verlust einer nahestehenden Person) diagnostiziert werden - wäre es nicht eher als Störung anzusehen, wenn jemand nur 2 Wochen um eine geliebte Person trauert? Auf systemischer Sicht wäre es vielmehr begrüßenswert, wenn "Diagnose-Stempel" so zurückhaltend wie möglich vergeben würden und eine Behandlung, die auf Autonomie und Resilienz der Betroffenen abzielt, schon bei der Diagnostik beginnt.
Bipolare affektive Störung
Sie (ICD-10: F31) ist durch depressive und manische Phasen gekennzeichnet. In der Manie (ICD-10: F30) dominiert bei den Betroffenen ein übersteigertes Selbstverständnis, bei dem auch die eigenen Fähigkeiten überschätzt werden. Patienten in der manischen Phase können wochenlang die Nächte durcharbeiten, ohne Müdigkeitserscheinungen wahrzunehmen, sie sind hochmotiviert und zuversichtlich. Bei "pathologischen SpielerInnen" (Volksmund) etwa ist häufig eine bipolare Störung diagnostizierbar: in der manischen Phase sitzen sie dann am Spieltisch und verspielen, von ihrem Erfolg überzeugt, große Mengen Geld. Darauf folgt jedoch unausweichlich wieder eine depressive Phase – bei Spielern der Zusammenbruch, im Zuge dessen sie realisieren, in welch schwierige Situation sie sich manövriert haben. Dann dominieren Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit – das Leben in dieser Welt wird als weitaus grauer und unbewältigbarer empfunden, als es tatsächlich ist.
Dysthymie und Zyklothymie
Bei der Dysthymie (ICD-10: F34.1) sind die depressiven Symptome etwas weniger ausgeprägt als bei der unipolaren Depression. Sie beginnen aber oft schon im Jugendalter und verlaufen chronisch, erstrecken sich also über weite Lebensabschnitte.
Bei der Zyklothymie (ICD-10: F34), dem bipolaren Gegenstück zur Dysthymie, kommt es zu leichter ausgeprägten manischen und depressiven Phasen.
Winterdepression
Von einer saisonal abhängigen Depression (SAD) spricht man, wenn die depressiven Symptome regelmäßig im Herbst oder Winter auftreten und im Frühjahr oder Frühsommer wieder vergehen. Diese Form der Depression dauert also höchstens fünf bis sechs Monate an. Das typische Anzeichen ist die Energielosigkeit, weniger die depressive Verstimmung. "Winterdepression" ist jedoch keine wissenschaftliche Diagnose, in Bezug auf diese am ehesten den 'depressiven Episoden' (s.o.) zuzuordnen.
![]()
Online-Selbsttest
Auf dieser Website finden Sie einen auf den Kriterien des DSM IV basierenden 'Depressions-Selbsttest', der einen gewissen Überblick darüber geben kann, ob Verdacht auf eine depressive Störung vorliegt.![]()
Wenn alles sinnlos erscheint – Suizidgedanken
 "Suizid" – "Freitod" – "Selbsttötung" – "Selbstmord" – unter diesen Begriffen wird die absichtliche, oft vorher angedrohte Vernichtung des eigenen Lebens verstanden. Besonders häufig sind suizidale Phasen bei langjährigen, schweren Formen der Depression, können aber auch bei psychisch ansonst Gesunden, etwa als Endpunkt einer abnormen seelischen Entwicklung vorkommen oder in Folge psychisch außergewöhnlich belastender Lebensereignisse.
"Suizid" – "Freitod" – "Selbsttötung" – "Selbstmord" – unter diesen Begriffen wird die absichtliche, oft vorher angedrohte Vernichtung des eigenen Lebens verstanden. Besonders häufig sind suizidale Phasen bei langjährigen, schweren Formen der Depression, können aber auch bei psychisch ansonst Gesunden, etwa als Endpunkt einer abnormen seelischen Entwicklung vorkommen oder in Folge psychisch außergewöhnlich belastender Lebensereignisse.
Der Suizid ist nach dem Unfalltod die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen. In Deutschland sterben zur Zeit täglich drei Kinder und Jugendliche durch Suizid, weitere 40 Kinder versuchen jeden Tag, sich das Leben zu nehmen. Die Anzahl der jugendlichen Selbsttötungen ist in Großstädten durchschnittlich doppelt so hoch wie auf dem Lande, in ländlichen Bereichen mit starkem Drogenkonsum (wozu bekanntlich auch Alkohol zählt), aber 50% über dem normalen Schnitt. Mädchen unternehmen ca. 3x so häufig Suizidversuche wie Jungen, deren Suizidversuche jedoch enden 3x häufiger mit dem Tode, da sie meist harte Suizidmethoden wählen, wie z.B. Erhängen oder Erschießen. Die Selbsttötungsgefahr ist bei Schülern höher als bei Jugendlichen, die sich bereits in der Berufsausbildung befinden, und bei diesen höher als bei Erwachsenen. Die meisten Suizidversuche werden im Frühjahr, im Herbst und überwiegend montags gezählt.
Die Themen "Depression von Kindern" und ganz speziell "Suizid durch Kinder und Jugendliche" sind gesellschaftlich in höchstem Masse tabuisiert, die meisten Eltern fürchten eine Stigmatisierung als Versager, würde ihnen jemand dafür die Verantwortung zuschreiben, dass ihr Kind derart "unglücklich" ist. Suizidversuche von Kindern werden deshalb häufig als Unglück, z.B. Unfall dargestellt. Dabei könnte gerade Kindern bei depressiven Zustandsbildern gut geholfen werden – Eltern, die sich selbst eingestehen, dass sie selbst ihrem Kind in einer solchen Situation nicht ausreichend helfen können und sich professioneller Unterstützung anvertrauen, tun diesem daher sicherlich Gutes.
Strafrechtliche Aspekte
Die Selbsttötung ist in keinem der mitteleuropäischen Länder gesetzlich verboten. Für Ärzte besteht erst dann Hilfspflicht, wenn der Suizidant die Herrschaft über den von ihm veranlaßten Geschehensablauf verloren hat. Nach deutschem Recht ist weder der Versuch des Suizids noch die Teilnahme daran strafbar. Strafbar macht sich jedoch unter Umständen, wer die Selbsttötung eines Willensunfähigen oder Irrenden veranlaßt oder geschehen läßt. Nach österreichischem Recht (§78 StGB) und Schweizer Recht (Art. 115 StGB) ist Verleitung und Beihilfe zum Suizid strafbar. (A: "Vergehen", CH: "Verbrechen"). Zusätzlich sind in der Schweiz für die Strafbarkeit selbstsüchtige Beweggründe des Anstiftenden bzw. Gehilfen erforderlich.
(Werbeeinschaltung)
Das "präsuizidale Syndrom" nach Ringel
Der bekannte Wiener Suizidforscher, Psychiater und Psychotherapeut Erwin Ringel untersuchte im Jahr 1949 insgesamt 745 Personen nach Suizidversuchen mit dem Ziel, deren psychische Verfassung vor dem Ereignis zu klären. Er konnte dabei eine immer wiederkehrende Struktur herausarbeiten, die er als präsuizidales Syndrom bezeichnete (Ringel 1953).
Dieses Zustandsbild ist durch eine zunehmende Einengung charakterisiert. Dabei wird eine Einengung der persönlichen Möglichkeiten erlebt, etwa als Folge von Schicksalsschlägen oder eigenem Verhalten. Folgenschwer ist dabei jenes Einengungsgefühl, das am Übergang zur Einengung in eine suizidale Dynamik steht: sukzessive werden dann Erlebnis-, Wahrnehmungs- und Denkinhalte anders als unter normalen Umständen erfaßt, und auch anders als sonst mit Affekten und Verhalten verknüpft. Die affektive Einengung bewirkt meist ein ängstlich depressives Verhalten bis hin zu "auffälliger Ruhe". Dazu kommt es zu einer Einengung der Wertewelt sowie zu Einengungen und Entwertungen zwischenmenschlicher Beziehungen, was bis zum Verlust der Umweltbeziehungen gehen kann.
Zusätzlich kommt es zur sog. gehemmten Aggression – Ringel weist erstmals darauf hin, dass eine Suizidhandlung eine enorm aggressive Handlung ausdrückt, die von den Betroffenen aber nicht anders ausgedrückt und kanalisiert werden kann als gegen sich selbst. Die drei Bausteine zunehmende Einengung, gehemmte Aggression und Suizidphantasien, können sich in einem verhängnisvollen Zusammenspiel ständig verstärken. So wird die Isolierung die Möglichkeiten der Aggressionsentladung vermindern, die Einengung der Gedanken- und Gefühlswelt in die depressive Richtung wird Suizidphantasien fördern, das Überhandnehmen von Suizidvorstellungen wieder Angstaffekte freisetzen und eine bestehende dynamische Einengung besonders leicht das Gefühl vermitteln können, es sei auch eine situative Einengung, d.h. nicht nur "eingebildete" Ausweglosigkeit gegeben. (Nindl 2003)
In sämtlichen Stadien des präsuizidalen Syndroms ist aber Hilfestellung möglich. Auf derartige Krisensituationen zurückblickend, berichten die Betroffenen häufig, das, was damals in ihnen vorging, "selbst nicht zu verstehen", erinnern sich jedoch noch gut, damals selbst – und ohne äußere Hilfe – sonst keinen Ausweg mehr gesehen zu haben als den Suizid. Es handelt sich also um psychische Ausnahmesituationen, in denen das Bewußtsein aus eigenen Resourcen heraus keine Möglichkeit mehr wahrnimmt, sich selbst aus der Krise zu befreien - mit Hilfe von außen allerdings kann plötzlich aber doch wieder ein Horizont sichtbar, und der eigene Handlungsspielraum wieder spürbar werden.
Statistisch sind eindeutig Verbindungen zwischen Depression und Suizid nachweisbar. 1999 starben in den USA doppelt so viele Menschen an Depressionen als an Morden – eine alamierende Zahl. 90% dieser Suizide ging prinzipiell diagnostizierbares psychisches Leiden voraus, am häufigsten davon Depression. 75% aller wiederholten Selbsttötungsversuche erfolgten durch Menschen, die keinerlei medikamentöse oder psychotherapeutische Behandlung erhielten. Man kann sich angesichts dieser Zahlen und des weiter oben beschriebenen typischen Umgang mit Depressionen (selbst durch Hausärzte) leicht vorstellen, wie "nahrhaft" der Boden für Depressionen bei Menschen allgemein ist. Umso wichtiger wird die korrekte Diagnose und das Ernstnehmen dieser Symptomatik durch die Betroffenen selbst sowie eine frühestmögliche, adäquate Behandlung. 70% der Patienten, die behandelt werden, erfahren verhältnismäßig rasch eine signifikante Reduktion der Symptomatik, unter der sie zu leiden hatten.
Referenzen
Harris Interactive, The painful truth Survey,
durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Harris Interactive im Jahre 2006 in Deutschland, Frankreich, Canada,
Brasilien und Mexiko) mit 377 depressiven Patienten und 756 Ärzten im Auftrag der World Federation of Mental Health
Institute of Medicine.
Reducing Suicide: A National Imperative. Washington, DC: National Academies Press; 2002:33. Quoted in Insel TR, Charney DS. Research on major depression: Strategies and priorities. JAMA. 2003;289:3167-3168.
Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. The epidemiology of major depressive disorder: results from the National Comorbidity Survey Replication. JAMA. 2003;289:3095-3105. Quoted in Glass RM.
Awareness about depression: Important for all physicians. JAMA. 2003:289:3169-3170.
Weissman MM, Bland RC, Canino GJ, et al. Cross-national epidemiology of major
depression and bipolar disorder. JAMA. 1996;276:293-299. Quoted in Glass RM.
Stewart WF, Ricci JA, Chee E, et al. Cost of lost productive work
time among US workers with depression. JAMA. 2003;289:3135-3144. Quoted in Glass RM.
Frasure-Smith N, Lespérance F, Talajic M. Depression following myocardial
infarction: impact on 6-month survival. JAMA. 1993;270:1819-1825. Quoted in Insel TR, Charney DS.
Krishnan KR, Delong M, Kraemer H, et al. Comorbidity of depression with other
medical diseases in the elderly. Biol Psychiatry. 2002;52:559-588. Quoted in Insel TR, Charney DS.
Lustman PJ, Clouse RE. Treatment of depression in diabetes: impact on mood
and medical outcome. J Psychosom Res. 2002;53:917-924. Quoted in Insel TR, Charney DS.
US Preventive Services Task Force. Screening for depression: recommendations and rationale. Ann Intern Med. 2002;136:760-764. Quoted in Glass RM.
Glass RM. Awareness about depression: Important for all physicians. JAMA. 2003:289:3169-3170.
Conwell Y. Suicide in later life: a review and recommendations for prevention. Suicide Life Threat Behav. 2001;31(suppl):32-47. Quoted in Insel TR, Charney DS.
Institute of Medicine. Reducing Suicide: A National Imperative. Washington, DC: National Academies Press; 2002:99. Quoted in Insel TR, Charney DS.
Hawton K, Houston K, Shepperd R. Suicide in young people: study of 174 cases, aged under 25 years, based on coroners and medical records. Br J Psychiatry. 1999;175:271-276. Quoted in Insel TR, Charney DS.
Insel TR, Charney DS. Research on major depression: Strategies and priorities. JAMA. 2003;289:3167-3168.
Kompetenznetz Depression; T. Payk: Checkliste Psychiatrie und Psychotherapie, 4. Auflage; Möller, Laux, Deister: Psychiatrie und Psychotherapie, 2. Auflage
Gerhard Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit; Kognitive Neurobiologie, Suhrkamp 1997
Gerhard Roth, Mario F. Wullimann: Brain Evolution and Cognition; John Wiley, 2000
Gerhard Roth, Wie der Geist im Gehirn entsteht, Universitas 2: 103-107, 2000
Helmert U (2003) Soziale Ungleichheit und Krankheitsrisiken. Maro Verlag, Augsburg
Mielck A (2000) Soziale Ungleichheit und Gesundheit (Zweitbuch). Empirische Ergebnisse, Erklärungsansätze, Interventionsmöglichkeiten. Verlag Hans Huber, Bern Göttingen Toronto Seattle
Lampert T, Ziese T (2005) Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit. Expertise des Robert Koch-Instituts zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung, Berlin
Lampert T (2005-04), Schichtspezifische Unterschiede im Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten. Blaue Reine des Berliner Zentrum Public Health
1 Literatur-Empfehlungen speziell zum Thema Neuronaler Plastizität bzw. Neuroplastizität
![]()
Literatur-Liste - speziell zum Thema "Depression"
Literatur-Tipps - zum Thema von mir empfohlen
Depression-Selbsttest - Selbsttest auf Depression
Psychotherapie-Forum - Fragen stellen oder persönliche Anmerkungen machen


