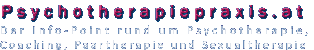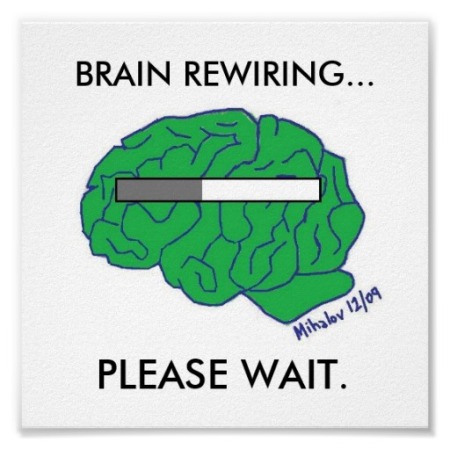Diabetes: Stress-Reduktion hilft
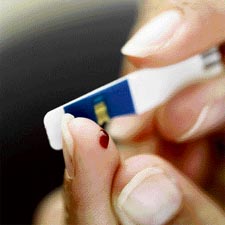
Diabetiker, haben langfristig weniger gesundheitliche Schäden und psychische Probleme – und damit eine höhere Lebenserwartung, wenn sie sich besser zu entspannen und den psychischen Umgang mit ihrer Erkrankung erlernen. Dies fand die kürzlich im Magazin “Diabetes Care” veröffentlichte Heidelberger Diabetes und Stress-Studie (HeiDis) heraus, die erste kontrollierte klinische Studie, die den Effekt von Stressreduktion auf […]