
Wo sind…
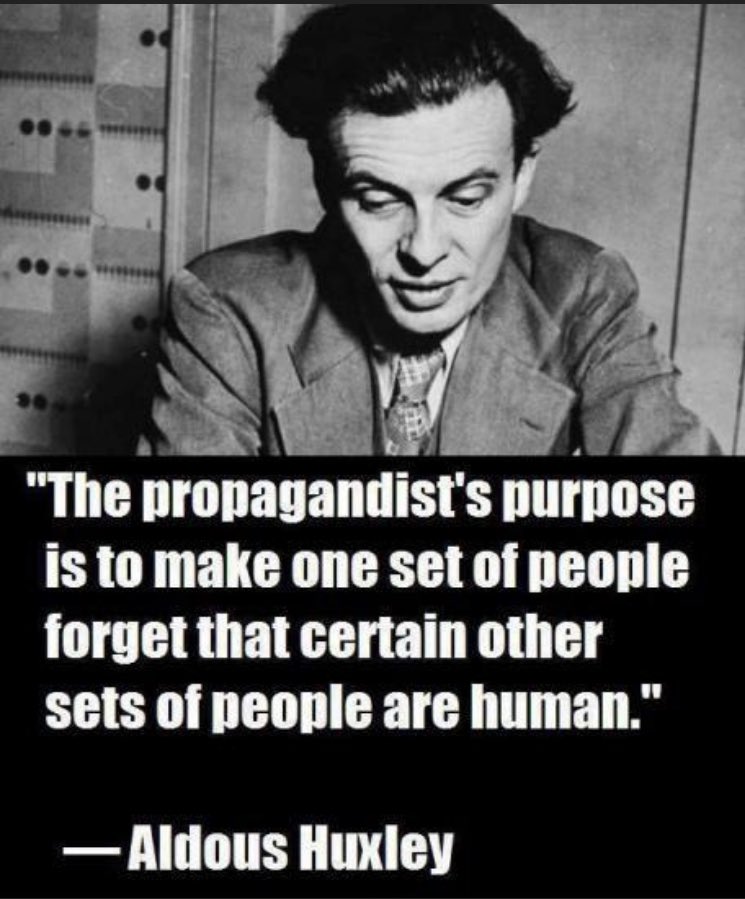
Die Covid-Pandemie ist ein Lackmus-Test nicht nur für die Demokratie, sondern auch für unsere eigene Positionierung zwischen billigem Zurschaustellen von Moralismus und standhaftem Eintreten für humanistische Grundwerte.

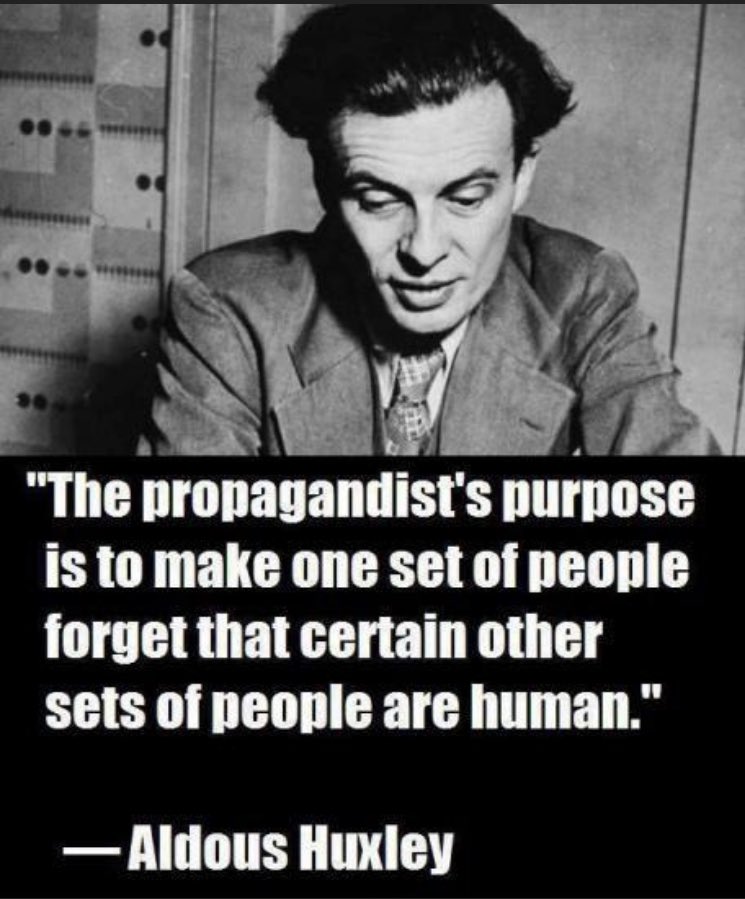
Die Covid-Pandemie ist ein Lackmus-Test nicht nur für die Demokratie, sondern auch für unsere eigene Positionierung zwischen billigem Zurschaustellen von Moralismus und standhaftem Eintreten für humanistische Grundwerte.

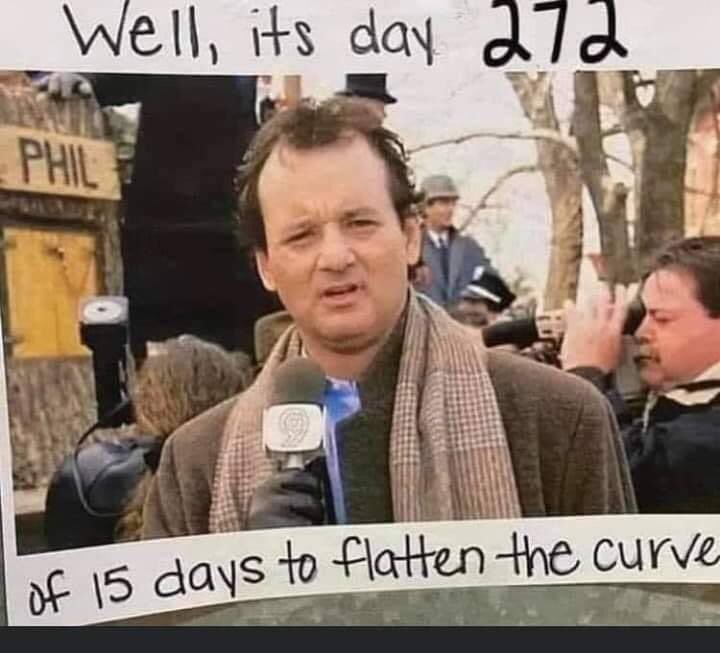
Über die psychosozialen und gesellschaftlichen Folgekosten der Covid-19-Maßnahmen und des Risikos totalitärer Entwicklungen.

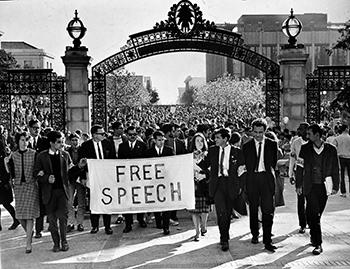
Dieser Tage wurde ein bemerkenswerter “offener Brief” im “Harper’s Magazine” veröffentlicht: über 150 bekannte Autoren und Intellektuelle wie Margaret Atwood, Noam Chomsky, Salman Rushdie, J. K. Rowling, Khaled Khalifa oder Daniel Kehlmann drückten darin ihre Unterstützung für die jüngsten Proteste gegen Polizeibrutalität und Rassismus in den USA aus. Gleichzeitig kritisieren sie aber auch, dass “der […]


Politische Einstellungen basieren auf freien Entscheidungen und jeder sollte die Freiheit haben, zu seinen Überzeugungen zu stehen – das stellt einen Grundpfeiler der westlichen Demokratien dar. Doch jüngste Untersuchungen zeigen, dass diese Freiheit tatsächlich vielleicht nicht so groß ist, wie wir das bisher annahmen, da viele dieser Einstellungen im Hirn “fest verdrahtet” und z.T. auch […]


Laut Statistik der Spielsuchthilfe, der ältesten Spieler-Betreuungseinrichtung in Österreich, hat jeder dritte Spielsüchtige vor seinem 19. Geburtstag zu spielen begonnen, und die Zahl der Jugendlichen, die ihr Geld am Glückspielautomaten verspielen, nimmt ständig zu. Bereits 15.700 Automaten stehen in Österreich, die als “Kleines Glücksspiel” vom staatlichen Glücksspielmonopol ausgenommen sind, in der Bundeshauptstadt rund 3.500 davon. […]


Im Diskussionforum meiner Website wurde von einer Userin dieser Tage eine Frage aufgeworfen, die ich sehr interessant fand: kann ein Fachmann (Psychiater/Psychologe/..) einen Amokläufer tatsächlich schon “vorzeitig” erkennen? Ich schicke voraus, daß ich ja nur ein “einfacher, kleiner Psychotherapeut” 😉 bin, und nicht so hochdekoriert wie mancher der Proponenten, die derartiges fordern. Als solcher aber […]


20.01.2009: Barack Obama’s Amtseinführung. Ich erhalte die Anfrage einer Redakteurin, welche durch Obama’s Wahlspruch “Yes We Can!” zu einer Story über Selbstbewußtsein und positives Denken inspiriert wurde. Könnte ich dazu ein paar Gedanken beitragen? Nicht, daß mir gerade heute langweilig gewesen wäre – aber ich hatte mir schon öfters zu Obama’s Wirkung auf die Menschen […]


Wer während der letzten Wochen die diversen Pressemeldungen verfolgte, konnte ein bemerkenswertes Bild über unseren gesellschaftlichen Zugang zu den “Umtrieben” heutiger Kinder und Jugendlicher bekommen: da wurde von einem oberösterreichischen Schuldirektor den SchülerInnen etwa das öffentliche Küssen untersagt (nach vehementen öffentlichen Protesten ist das Verbot mittlerweile wieder aufgehoben), angeblich werden Jugendliche immer dümmer (Computer und […]


Barack Obama neuer US-Präsident Selbst seine größten Kritiker müssen einräumen, dass sein Wahlkampf seinesgleichen in der Geschichte der USA, ja der Welt sucht, und vermutlich auch in Zukunft Maßstäbe setzen wird. Barack Obama verstand es wie kein anderer westlicher Politiker der jüngeren Geschichte, die Menschen zu mobilisieren. Viel wurde bereits über seine Ausnahmeerscheinung diskutiert und […]


Nun sind sie also wieder wohlbehalten zurückgekehrt, die österreichischen Geiseln. Vor 8 Monaten im Grenzgebiet zwischen Tunesien und Algerien von der terroristischen Nachfolgeorganisation der sog. “Algerischen Salafisten-Gruppe für Predigt und Kampf” (GSPC) nach Mali verschleppt, hat der Alptraum für das Paar zuletzt ein glückliches Ende gefunden. Nun beginnt für sie -wie für viele Entführungsopfer- der […]